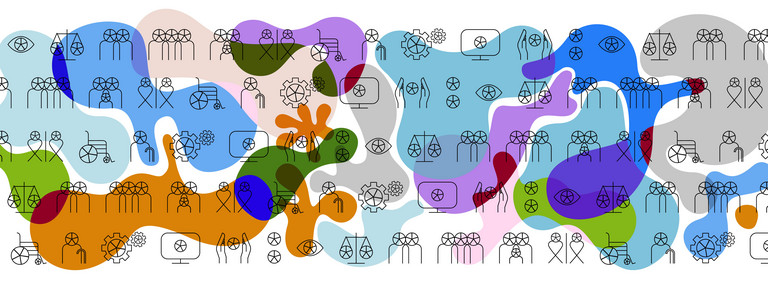Neuerscheinung: Auf dem Weg zur Normalität? LGBTQ+-Familien und ihr Kampf um Anerkennung
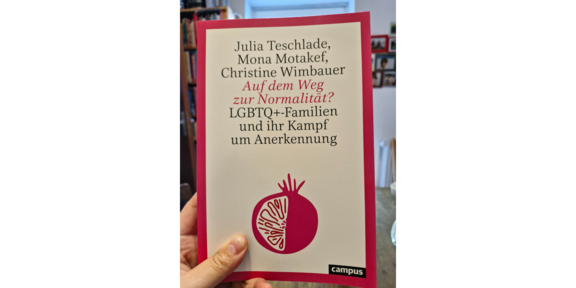
Auf dem Weg zur Normalität? LGBTQ+-Familien und ihr Kampf um Anerkennung
LGBTQ+-Familien – also lesbian, gay, bisexual, trans* und queere Familien – sind in den letzten Jahren sichtbarer geworden. Auch im Recht zeichnen sich im deutschsprachigen Raum ambivalente Tendenzen der Gleichstellung ab: Zwar werden Anerkennungsdefizite gleichgeschlechtlicher Lebensformen abgebaut, etwa mit der „Ehe für alle“ (2017) und dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) (2024), Ungleichheiten und Diskriminierungen bestehen aber fort und es zeigen sich auch neue Ausschlüsse.
In dem neuen Buch von Julia Teschlade, Mona Motakef, Christine Wimbauer „Auf dem Weg zur Normalität? LGBTQ+-Familien und ihr Kampf um Anerkennung“ kommen LGBTQ+-Familien selbst zu Wort. Die zugrundeliegende Studie „Ambivalente Anerkennung. Doing reproduction und doing family jenseits der heterosexuellen Normalfamilie“ wurde von der DFG finanziert (AZ MO 3194/2-1, PE 2612/2-1, WI 2142/7-1). Sie basiert auf 19 ausführlichen Paar- und Familieninterviews sowie Einzelinterviews und ist im Forschungsstil der Grounded Theory verfasst.
Wie werden Kinderwünsche in LGBTQ+-Familien realisiert (doing reproduction)? Welche Ungleichheiten und (rechtlichen) Hürden zeigen sich für die Familien dabei in ihrem Alltag? Wie gehen sie mit diesen Hürden und Ungleichheiten um (doing family und doing normality)? Theoretisch ist unsere Studie geschlechter-, ungleichheits- und anerkennungstheoretisch fundiert.
LGBTQ+-Personen wurde lange abgesprochen, überhaupt Familien gründen zu können. Die Autorinnen zeichnen ihre oft hürdenreichen Wege in die Elternschaft nach und stellen auf Grundlage vielfältiger rechtlicher Ungleichheiten für LGBTQ+-Familien dar, wie diese Ungleichheiten im Familienalltag von zwei-Mütter-, Mehreltern- und trans*-Familien zum Tragen kommen. Aber auch alltäglich sind LGBTQ+-Familien von rechtlichen, institutionellen und intersubjektiven Ungleichheiten betroffen. Sie sehen sich häufig vor der Aufgabe, die „Normalität“ ihrer Familie zu behaupten. Teschlade, Motakef und Wimbauer fassen dieses Normalisierungshandeln nicht als unpolitische Anpassung, sondern als existenziell notwendige Antwort auf erlebte Ungleichheiten und Diskriminierung. Dabei arbeiten sie unterschiedliche Strategien heraus, wie die Familien Normalität herstellen (müssen). Schließlich richten sie den Blick auf ungleiche Anerkennung der Familien. Im Anschluss an Butler und Honneth arbeiten sie heraus, in welchen Dimensionen Anerkennungsdefizite bestehen. Anschließend systematisieren sie die vielfältigen Kämpfe um Anerkennung, die die Familien angesichts der erfahrenen Anerkennungsdefizite führen. Zuletzt diskutieren sie, ob durch subversives Handeln neue Selbstverständlichkeiten an Bedeutung gewinnen können. Die von befragten Familien greifen auch auf (heterosexuelle) Familiennormen zurück. Damit verändern sie gleichzeitig die rechtlichen und gesellschaftlichen Normalvorstellungen darüber, was Elternschaft und Familie ist und sein kann. Übergreifend wird deutlich, dass sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zentrale Determinanten sozialer Ungleichheit sind und weitreichend über Handlungsmöglichkeiten und Lebenschancen mitbestimmen.
Kontakt:
Dr. Julia Teschlade, Humboldt-Universität zu Berlin, julia.teschladehu-berlinde
Prof. Dr. Mona Motakef, TU Dortmund, mona.motakeftu-dortmundde
Prof. Dr. Christine Wimbauer, Humboldt-Universität zu Berlin, christine.wimbauersowi.hu-berlinde